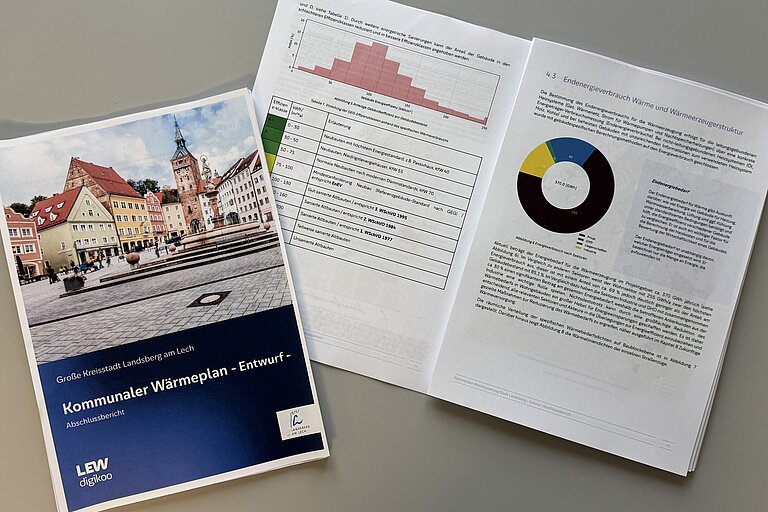Entwurf der kommunalen Wärmeplanung für Landsberg am Lech vorgelegt
Strategischer Fahrplan für klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045 entwickelt
Die Stadt Landsberg am Lech hat gemeinsam mit den Lechwerken (LEW) und dem Planungsbüro digikoo den Entwurf des Endberichts der kommunalen Wärmeplanung erarbeitet. Das Konzept zeigt rahmengebend auf, wie die Wärmeversorgung in der Stadt bis 2045 klimaneutral gestaltet werden kann.
Vier systematische Schritte zur Wärmewende
1) Bestandsanalyse: Zunächst wurde der aktuelle Wärmeverbrauch für Heizung, Warmwasser und Industrieprozesse erfasst und dokumentiert, welche Heizungsanlagen und Energiequellen vorhanden sind. Grundlage bildeten dabei Daten der Stadtwerke, des Gasnetzbetreibers und der Kaminkehrer.
Die Analyse der rund 7.000 untersuchten Gebäude – davon 69 Prozent Wohngebäude – offenbart deutlichen Handlungsbedarf: Knapp drei Viertel der Wärmeversorgung in Landsberg basiert derzeit auf fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Heizöl. Der jährliche Wärmebedarf liegt bei etwa 370 GWh Endenergie, das verursacht jährlich 86.000 Tonnen CO₂-Emissionen, wobei der Wohnbereich mit 73 Prozent den größten Anteil ausmacht. Wenigen Gebäuden die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, steht ein fast flächendeckend ausgebautes Gasnetz gegenüber.
2) Potenzialanalyse: In der anschließenden Potenzialanalyse wurden verfügbare erneuerbare Energiequellen (wie Umweltwärme, Abwärme, Abwässer, oberflächennahe und tiefer Geothermie, sowie Biomasse) untersucht, sowie Einsparmöglichkeiten durch Gebäudesanierungen berechnet. Hier zeigte sich, dass vor allem solare Strahlungsenergie auf Dächern sowie Umweltwärme durch Wärmepumpen besonders für dezentrale Lösungen großes Potenzial biete. Durch umfassende energetische Sanierung aller Gebäude könnte der Wärmebedarf um bis zu 16,5 Prozent gesenkt werden.
3) Szenarienentwicklung 2045: Mit einem strategischen Gesamtblick entwickelten die Planer ein Zielszenario für 2045 und teilen das Stadtgebiet anhand von Simulationsrechnungen in Bereiche mit unterschiedlichen Versorgungslösungen ein. Dabei werden verschiedene Kriterien wie Wärmeliniendichte, Bestandsnetze, potenzielle Ankerkunden, Baualtersklassen, Gebäudekategorien, Heizungsanlagenalter, lokale Strom- und Wärmeerzeugungspotenziale sowie Restriktionen berücksichtigt. Laut Prognose werden 2045 rund 65 % des Wärmebedarfs durch Wärmepumpen gedeckt, 17 % durch Wärmenetze und 13 % durch Biomasse und 5% Sonstige. Der gesamte Endenergiebedarf sinkt deutlich und verschiebt sich vollständig auf regenerative Energieträger.
Der Wärmeplan definiert verschiedene Versorgungsstrategien je nach Stadtteil: In der dicht bebauten Altstadt soll das Wärmenetz weiterentwickelt werden, wobei eine innovative Flusswärmepumpe eine bestehende Gas-BHKW-Anlage ersetzen und das Wärmenetz klimaneutral versorgen soll. Bestehende kleinere Wärmenetze werden an anderen Stellen erweitert. Hier ist der Übereinklang der Ergebnisse und Vorschläge aus der Wärmeplanung mit den bereits erfolgten Planungen der Stadtwerke Landsberg am Lech eine deutliche Bestätigung beider Strategien.
4) Umsetzungsstrategie: Die konkrete Umsetzungsstrategie mit Zeitplan und Maßnahmen führt schließlich alle Teile der Untersuchung zusammen. Insgesamt wurden 13 konkrete Maßnahmenvorschläge entwickelt, die sowohl technische Projekte als auch unterstützende Angebote umfassen. Dazu gehört etwa der Vorschlag das Fokusgebiet Schwaighofsiedlung hinsichtlich der räumlichen Gegebenheiten, der wirtschaftlichen Eignung und Umsetzung zu untersuchen, um ein solides Konzept für ein Wärmenetz zu erstellen. Auch die systematische Integration der Wärmeplanung in die Strukturen der Stadtverwaltung und Stadtwerke ergibt sich aus den Maßnahmenvorschlägen.
Die Transformation erfordert Investitionen aller Beteiligten, bietet aber auch Chancen für lokale Wertschöpfung und größere Energieautarkie. Fossile Energieträger werden mit steigenden Preisen und CO₂-Bepreisung zunehmend unattraktiver.
„Der kommunale Wärmeplan bietet als informelles Planungsinstrument eine wertvolle Orientierung für die zukünftige Wärmeversorgung – auch wenn daraus kein unmittelbarer Rechtsanspruch auf Umsetzung entsteht. Er schafft mehr Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen und gibt Orientierung, welche Heizlösung in welchem Stadtteil langfristig sinnvoll ist. Die Wärmewende kann nur durch die Zusammenarbeit aller lokalen Akteure gelingen – von der Kommune über Stadtwerke bis hin zu Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern und Handwerksbetrieben“, so Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.
Wie geht es mit der kommunalen Wärmeplanung weiter?
Hier steht der Entwurf der kommunalen Wärmeplanung zum Download bereit.
Infos zur Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen sind auf der Detailseite https://www.landsberg.de/rathaus/bauen-wohnen/energie-umwelt/kommunale-waermeplanung-2/
zu finden.
Nach der Veröffentlichung besteht insgesamt 30 Tage lang - bis 22. September 2025, 12:00 Uhr - die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Die eingegangenen Stellungnahmen werden in den Erarbeitungsprozess integriert und der Umgang mit diesen im Rahmen der Vorstellung des finalen Wärmeplans in öffentlicher Stadtratssitzung präsentiert.